Der Zwang zur Arbeit
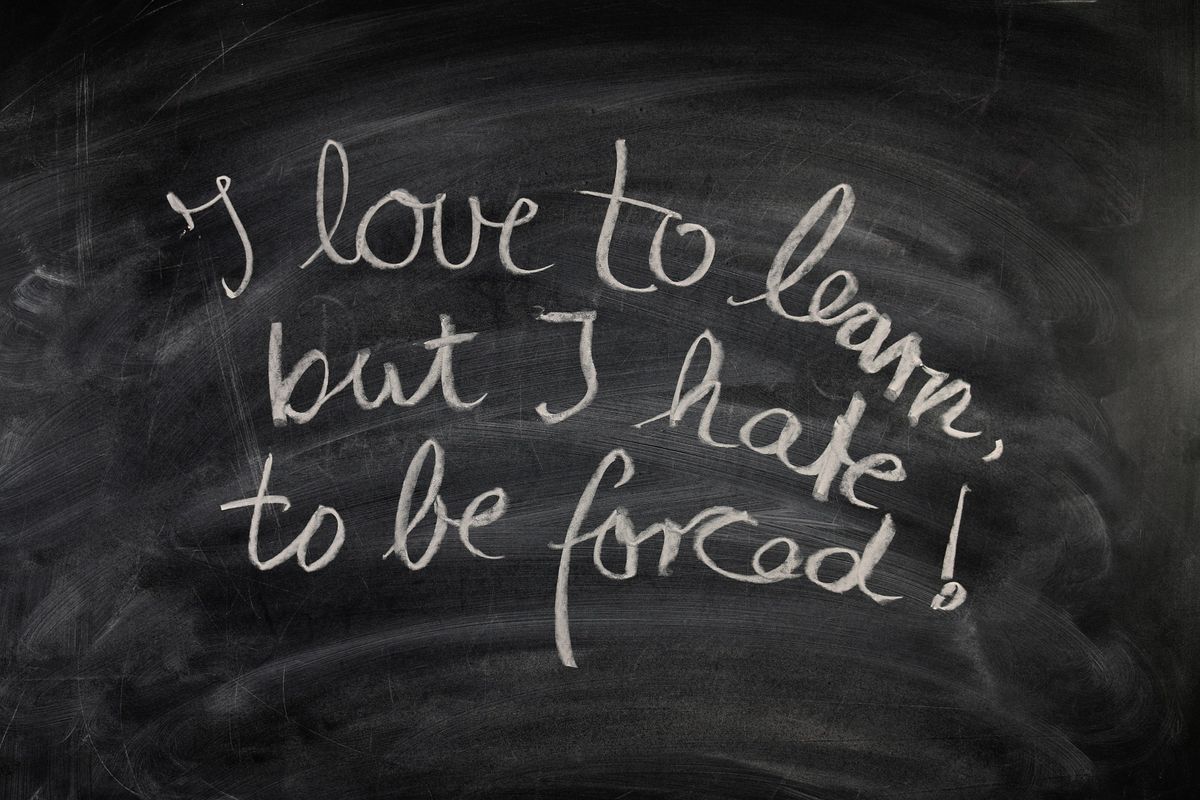
Über die Art und Weise, wie New Work gelebt werden müsse und wie eine neue Interpretation der Arbeit auch für das Überleben unserer Spezies notwendig ist, schreibt Hans Rusinek eindrücklich in seinem Buch Work Survive Balance. Er gibt legitime Aussagen und Punkte wieder, die den Nerv der Zeit sehr gut treffen und verbindet diese mit eigenen Anekdoten und Erfahrungen. Ich vermisse jedoch eine skeptische Grundhaltung gegenüber der Arbeit im Allgemeinen. Warum muss ich arbeiten? Warum kann ich nicht einfach meinen Bauch in die Sonne halten und mich des Lebens erfreuen? Aber der Reihe nach.
Wie ich das System zu kritisieren lernte
Wenn ich an Arbeit denke, denke ich vor allem an Produktivität und Effizienz. Zwei Termini, mit denen ich in meinem persönlichen Leben eher unangenehme Erfahrungen gemacht habe. Dies begann bereits zu Beginn meiner schulischen Laufbahn, wie ich in einer kürzlich zurückliegenden Therapiesitzung festgestellt habe: Meine Kindergartenzeit war in Retrospektive eine, die einer meiner Meinung nach erstrebenswerten Lernatmosphäre sehr ähnlich kommt. Damit ist vor allem der nicht vorhandene Druck gemeint, produktiv und effizient sein zu müssen. Spiel und Spaß wurden erwartungsgemäß priorisiert. Der Gedanke, etwas tun oder eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen zu müssen, war nicht vorhanden. So wurde der Kindergarten zu einem Ort, den ich gerne besuchte und der mir persönlich keine Ängste bereite. Meine allererste Erinnerung unter Druck zu stehen und in ein vorgegebenes Schema passen zu müssen, kam mit der sogenannten Schulvorbereitung. Es galt, einen Fisch auszumalen. Ich wollte aber keinen Fisch ausmalen. Ich wollte lieber weiterhin mit Freund:innen spielen. Warum wurde ich aus meiner täglichen Routine gerissen, die sich zugebenermaßen mit einer täglichen Routine nur darin ähnelte, dass sie alltäglich war? Sie ergab sich also jeden Tag von neuem. Jeden Tag wurde mir als 4 bis 5 jährigem Kind zugetraut, meinen Alltag zumindest teilweise selbst zu gestalten. Warum also wurde mir dieses Privileg weggenommen? Warum wurde mir diese Freiheit, die mir anvertraut wurde, nun ›abvertraut‹? Ich verstand nicht. Und dieses Unverständnis wandelte sich in meiner gesamten bisherigen Bildungslaufbahn nicht in Verständnis um. Im Gegenteil: Mein weiterer Bildungsweg – vor allem meine schulische Laufbahn – entwickelte sich zu einer für einen heutigen Film sicherlich ungeeigneten Storyline.Sie wäre zu langweilig einzig von der Dichotomie zwischen Ungehorsam und der indoktrinierten Überzeugung, Autoritäten respektieren zu müssen, ›weil man das eben so tut‹, hin und her schwankend. Es war mühsam.
Arbeit, aber nur, wenn ich will
Heute glaube ich jedoch zu wissen, warum mir Aufgaben aufgezwungen wurden. Warum mir meine Freiheit, meine Zeit selbst einteilen zu können, weggenommen wurde. Im Song 1517 der Band The Whitest Boy Alive singt Frontmann Erlend Øye »Freedom is a possibility only if you're able to say no«. Ein Satz, dessen Bedeutung mir erst bewusstwurde, nachdem ich mich mehr und mehr mit verschiedenen Arten von Privilegien auseinandergesetzt habe. Ich behaupte, der Zwang in der Schule diente dazu, mich auf das System Arbeit vorzubereiten. So wird Arbeit als ein Zwang dargestellt, den es zu akzeptieren gilt. Meiner Erfahrung nach setzt Widerstand innerhalb eines sozialen Systems voraus, dass die Widerstand leistende Person einen Status oder Privilegien genießt. Nur so kann sie Widerstand leisten, ohne gravierende Konsequenzen befürchten zu müssen. Und das können eben nicht alle; auf Arbeit zu verzichten können nicht alle.
Überwachen und Strafen
Angestoßen wurden meine Gedanken, wie man bereits erahnen kann, von Michel Foucaults Werk Überwachen und Strafen: In seinem Werk beschreibt Foucault, wie im 18. und 19. Jahrhundert Körperzüchtigungsstrafen durch Haftstrafen abgelöst wurden. Ziel war es, das Individuum durch Disziplinierung an vorgegebene, gesellschaftliche Normen anzupassen. Foucault weist darauf hin, dass diese Entwicklung nicht nur in Gefängnissen stattfand, sondern sich durch viele gesellschaftliche Institutionen zieht, wie zum Beispiel Schule und Unternehmen. Dabei werden in der jeweiligen Institution hierarchische Systeme implementiert, durch die Individuen, wie Lehrer:innen oder CEOs, in Machtpositionen gestellt werden. Die Macht besteht unter anderem darin, entscheiden zu können, was normal ist und was nicht. Bezogen auf meine Erfahrungen aus der Transitionszeit zwischen Kindergarten und Schule bedeutet das, dass sich das kindliche Individuum anpassen soll. Anpassen an ein System, das auf Gehorsamkeit beruht. Damit soll, meiner Meinung nach, die Verinnerlichung ökonomischer Produktivität und Effizienz einhergehen. Doch wozu?
Was Kapitalismus mit der ganzen Misere zu tun hat
Wie ich oben von Foucault zitierte, werden wir in eine Welt geboren, die von verschiedenen Machtbeziehungen durchdrungen ist. Dazu gehört auch die ökonomische Macht. Karl Marx schrieb in seinem Werk Das Kapital unter anderem, dass Arbeiter:innen nur ihre Arbeitskraft verkaufen könnten. Sie selbst könnten keine Waren verkaufen, weil die Produktionsmittel sich fast ausschließlich in den Händen der Kapitalist:innen befänden. Er beschrieb ein vereinfachtes gesellschaftliches Klassensystem, das sich durch Machtgefälle auszeichnet und sich folglich auch in den jeweilig verteilten Privilegien unterscheidet. Dieses Phänomen ist bis heute relevant. Und unsere Politik sieht zu. Thomas Piketty veröffentlichte 2013 sein Werk Das Kapital im 21. Jahrhundert. Er schreibt von einer Rückkehr in die 1970er-Jahre, zurück zum Patrimonialen Kapitalismus. Zentral für den patrimonialen Kapitalismus sei , dass er auf Vermögen und Erbschaften basiere. Am Beispiel Österreichs wirkt seine These plausibel. Hier erben circa 70 Prozent der Bevölkerung gar nichts. Die oberen 10 Prozent hingegen erben durchschnittlich 828.000 Euro. Tendenz steigend. Ihnen gehört auch etwa 56 Prozent des Nettovermögens. Die aktuelle österreichische Erbschaftspolitik bevorzugt strukturell eine elitäre Minderheit und bestärkt damit die Wiederkehr des patrimonialen Kapitalismus nach Piketty.
Wie New ist die Work wirklich?
Arbeit ist ein Produkt gesellschaftlicher Erwartung und je nach Kontostand und Dicke der Geldbörse verpflichtend Diese Umstände werden in Hans‘ Buch nicht ausreichend beachtet. Dies soll kein Vorwurf sein . Hans hat ein klasse Buch geschrieben, das meinen Horizont auf New Work bereichert hat. Die aktuelle Situation von und die Einstellung zu Arbeit zu kritisieren, ohne die grundlegende materielle Ungleichheit unserer Gesellschaft und damit einhergehend den – schon von Marx beschriebenen – Zwang zur Arbeit einzubeziehen, ist meiner Meinung nach jedoch nicht ausreichend. Eine Solche Kritik wird einer nachhaltigen und fairen Vorstellung von New Work nicht gerecht.
Weniger Ungleichheit, weniger Zwang
Der Zwang zur Arbeit resultiert vor allem aus ökonomischer Ungleichheit. Wer über New Work spricht, sollte also von ungleichen Vermögen nicht schweigen. Wenn es um klassistische Verhältnisse und ökonomische Ungleichheit der Gesellschaft geht, so hat Thomas Piketty wirkungsvolle Lösungen vorgestellt. Er schlägt eine internationale Kooperation und eine grundlegende Reform des Steuersystems im Sinne einer globalen Vermögenssteuer vor: zwei Prozent auf Vermögen von mindestens 10 Millionen Euro – für Betroffene wohl eine hinnehmbare Höhe. Erbschaftssteuern sind ebenso Teil seiner Agenda wie eine Stärkung der Gewerkschaften. Es gibt sie also, die Lösungsansätze auch für die ganz großen Probleme unserer Zeit. Wir haben ein Umsetzungs-, kein Erkenntnisproblem. Wäre der politische Wille vorhanden, lebten wir freier in einer besseren Welt.



